Zwischen Anti-Kolonialismus und imperialem Subjekt: Geschichtsbilder in 80 Days
Ein Beitrag zu den Interactive Fiction Days von Jan Heinemann, neu veröffentlicht für die Interactive Fiction Days II.

Wir springen in den Zug, der mit Höchstgeschwindigkeit auf den Ärmelkanal zurast, um dann plötzlich abzutauchen und sich unter Wasser seinen Weg nach Frankreich zu bahnen. Auf dem Gelände der Weltausstellung in Paris bekommen wir eine erste Vorahnung dessen, was uns auf der anstehenden Reise erwartet. Auf schnaufenden Wagen, die wortwörtlich von Dampfrössern über holprige Straßen gezogen werden, geht es durch Europa. Vorbei an der Roboterarmee Österreich-Ungarns, von Großstadt zu Großstadt, über das Mittelmeer oder quer durch Sibirien, in Wagen, auf Schiffen, mit Ballons oder Luftschiffen und immer wieder mit dem Zug erschließen wir uns nach und nach die Welt. Wir sind Passepartout, der Diener von Phileas Fogg, der Inkarnation des englischen Gentleman, der stets mit frisch gebügeltem Kragen, einer Zeitung und einer Tasse Tee, vor allem aber mit stoischer Ruhe daherkommt. Zwar befinden wir uns auf dieser Reise, weil Fogg eine Wette gewinnen will, dennoch treffen wir als Passepartout in 80 Days alle Entscheidungen und geben den Weg vor, auf dem wir die Weltumrundung bestreiten wollen. Und Wege gibt es viele.
80 Days: Eine Reise, die (nicht) die Welt verändert
80 Days von Inkle (auch bekannt für Sorcery! und das später erschienene Heaven’s Vault) vereint den Geist des Romanklassikers von Jules Verne mit Steampunk, progressiven Geschlechterbildern und Erfahrungen kolonialer Unterdrückung in der zunehmend globalisierten und modernistischen viktorianischen Welt des späten 19. Jahrhunderts, die von Imperialismus und technischem Fortschritt gleichermaßen geprägt ist. Dabei nutzt es das historisch inspirierte Setting, um ein inklusives Weltbild zu entwerfen und Unterdrückung und Ausbeutung aller Art zu problematisieren. Neben den unterhaltsamen Gesprächen, die vor allem durch ulkige Charaktere profitieren, begeistert das Spiel durch diese kritische Weltsicht und viele unscheinbare Einzelschicksale, welche die Spielerin die Dimensionen von Kolonialismus, Rassismus und Sexismus im Kleinen begreifen und in einen großen Kontext einordnen lassen. Doch auch 80 Days kann sich nicht völlig von einem eurozentristischen Blick auf die Welt lösen.
Der Umweg ist der Weg
Grundlage des Spiels ist ganz offensichtlich der berühmte Roman Le Tour du monde en quatre-vingt jours, In 80 Tagen um die Welt, den Jules Verne 1872 veröffentlichte. Für seine zu dieser Zeit unglaubliche Geschichte diente Verne der exzentrische Eisenbahngesellschafter George Francis Train als Vorlage, der 1870 behauptete, den Globus in 80 Tagen umrundet zu haben. Diesen Rekord konnte Train 1890 mit 67 Tagen Reisezeit noch unterbieten. Eine Reise, die auch zwei Frauen in unter 80 Tagen bewältigten: Nellie Bly und Elizabeth Bisland traten unter großer medialer Beachtung 1889/90 gegeneinander an, um zu beweisen, dass auch Frauen zu dieser Reise „in der Lage“ seien. Bly gewann den Wettstreit, sie benötigte für die Umrundung nur 72 Tage.
Der Speedrun im Spiel liegt bei 29 Tagen, doch eine solche Hatz wird dem Spiel nicht gerecht. Immerhin kann die Spielerin auf ihren Reisen um die Welt bis zu 175 Orte besuchen, dort und auf bestimmten Strecken 91 verschiedene Charaktere treffen und diverse Gegenstände erwerben und handeln. Diese Aufzählung, die wie ein klassischer Werbetext erscheint, beschreibt den Kern des Spiels. Denn die Spielwelt und damit die möglichen Reisewege werden erst im Laufe des Spiels aufgedeckt.

Die Schiffverbindung von Japan an die amerikanische Westküste ist teuer, vielleicht lohnt sich ein Umweg über Manila?
Bleiben wir eine Nacht länger, um möglicherweise eine schnellere Verbindung, eine neue Strecke, einen ganz anderen Weg zu einem unserer Zwischenziele zu finden? Sprechen wir mit Charakteren, damit diese uns möglicherweise auf schnellere Strecken, lokale Besonderheiten oder über die neusten Gerüchte informieren? Investieren wir Zeit, um ihnen Gefallen zu tun und Botengänge zu übernehmen, die uns zwar von unserer geplanten Route abbringen, aber später Vorteile bringen könnten? Investieren wir unsere knappen Finanzmittel, um Gegenstände zu kaufen, die wir zwar für viel Geld, aber nur an bestimmten Orten, gewinnbringend verkaufen können? Sollten wir lieber Ausrüstung kaufen, die uns für spezifische Fortbewegungsmittel oder in bestimmten Regionen der Erde Vorteile bringt? Sammeln wir bestimmte Ausrüstungssets für die aktuelle Region, vorausschauend für spätere Passagen oder von allem etwas? Brauchen wir kleine Leckereien oder Spiele, mit denen wir unseren Gesprächspartnerinnen unterwegs weitere Informationen entlocken können? Denn unser Gepäck ist begrenzt.
80 Days konfrontiert die Spielerin durchgehend mit Kontingenz, es wird selbst, in seiner gesamten Konstellation aus Spielmechanik und emanzipatorischem Impetus, zu einer einzigen großen Kontingenzgeschichte. So ist die Spielerin stets hin und her gerissen zwischen Nutzenkalkül und Neugier, was hinter den Orten und Charakteren steckt, zwischen Vorausplanung und irritierter Rückschau, welche Optionen womöglich die besseren gewesen wären, welche Geschichten und Strecken ihr verborgen geblieben sind. Es ist gerade diese Erzählweise, die Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Kolonalismus und Kriege als Absurditäten mit schlichter Menschlichkeit kontrastiert und damit radikal in Frage stellt, welche die Inkle-Gründer Joseph Humfrey und Jon Ingold gemeinsam mit Meg Jayanth gewählt haben. Die Reise selbst, der Wettlauf um die Welt gerät dabei beinahe zur Nebensache.
Die Menschen sind die Geschichte
Die besondere Perspektive und Narrativität verdankt das Spiel Meg Jayanth, die den Großteil der Texte für 80 Days geschrieben hat, und ihrer Herangehensweise an die Darstellung der Vergangenheit in digitalen Spielen. Um Jules Vernes eurozentristischen Entwurf in eine postkoloniale, emanzipatorische Diversität zu überführen, betont sie die Agency der Nicht-Spielerinnen-Charaktere, also deren Handlungsmächtigkeit. Zwar erlebt die Spielerin die Welt und die sich in ihr abspielenden emanzipatorischen Anliegen und revolutionären Bewegungen aus der Sicht des privilegierten Europäers Passepartout und kann in dieser Rolle die Anliegen marginalisierter Gruppen unterstützen – ohne jedoch gleichzeitig als white saviour, als weißer Retter, aufzutreten. Denn die Nicht-Spieler:innen-Charaktere haben ihre ganz persönlichen Ansichten, Vorbehalte, Wünsche und Ziele und bringen diese unabhängig von Passepartout zum Ausdruck, ohne dass dieser jemals eine führende Rolle einnehmen könnte.
»Just because there are historical injustices in a certain period, doesn’t mean that it is right to simply re-present them without commentary and context. And secondly: a little history can be a dangerous thing. Often our idea of history white-washed, devoid of important women, robbed of the voices and ideas of marginalized people. But if you dig a little bit deeper, history is full of women, people of colour, LGBTQ+ people living, working, innovating and fighting.« 1
Anschaulichstes Beispiel ist vermutlich Aouda, eine indische Prinzessin, die Fogg in Vernes Roman vor dem Scheiterhaufen rettet und als Liebschaft und quasi imperialistische Trophäe von seiner Reise mit nach London bringt. In 80 Days ist es Aouda, die möglicherweise Fogg und Passepartout rettet.
Im Gegenzug zur Stärkung der Agency der Nicht-Spielerinnen-Charaktere geht Jayanth davon aus, dass die Agency der Spielerin auch ohne spielverändernde Handlungsmacht gestaltet werden kann: »player agency does not have to translate into actions. Even if the player cannot directly affect something — if they can have an emotional response or reaction — for a game to allow them the space to have an opinion can be as powerful as allowing them to ›do something‹ — and giving protagonists this type of agency allows NPCs to have more development and depth, to pursue their goals without being constantly overriden by the protagonist’s overdeveloped sense of importance.« 2

Passepartout kann auch gleichgeschlechtliche amouröse Beziehungen unterhalten wie mit dem ehemaligen Sklaven Octave in New Orleans.
Die so entworfene Welt hat keinen Platz für Helden (sic!). Sie basiert gleichsam auf fantastischen und historischen Elementen, die durch den Grundsatz eines generell respektvollen Umgangs mit den vielfältigen und grundverschiedenen Akteurinnen des Spiels gleichsam eine Kritik historischer Unterdrückung wie gegenwärtiger gesellschaftlicher Verhältnisse praktiziert. »But there are also times we use fantasy to enable us to tell the kind of story we wanted to be able to tell, to redress some of the colonialism, sexism and racism of the period. If you’re inventing a world, why not make it more progressive?« 3
Eine Frage, die so wohl viel häufiger gestellt werden sollte. In 80 Days ermöglicht diese Herangehensweise die Vermittlung historischer Ungleichheiten und gleichzeitig beispielsweise die Darstellung gleichgeschlechtlicher oder queerer Beziehungen zwischen Nicht-Spielerinnen-Charakteren oder zwischen Nicht-Spielerinnen-Charakteren und Spielerin und umgeht gezielt den nostalgisch-eskapistischen Grundton vieler Steampunkfiktionen.
Ein dekolonisierter Globus?
Im Gegensatz zur Buchvorlage, in der Europa ein weißer Fleck auf der Landkarte und gleichsam separiert und überhöht bleibt, beginnt die Reise in 80 Days nach kurzer ›Überfahrt‹ im Unterwasserzug in Paris. Hierdurch ist es möglich, die europäischen Staaten, Städte und Menschen als ebenso alteritär, also anders und einzigartig darzustellen wie alle anderen Menschen an jedem anderen Ort der Welt. Die Steampunk-Elemente ermöglichen darüber hinaus alternative Geschichtserzählungen. So verhindert die Zulu Federation beispielsweise den Wettlauf um Afrika mit riesigen Maschinen. Überhaupt ist das Wissen über die »Automaton« genannte Maschinentechnologie durch die obskure »Artificers’ Guild«, die Gilde der Handwerker, im Spiel global etabliert und vernetzt. Warum bestimmte Teile der Welt dennoch durch Kolonialmächte, allen voran das British Empire, Frankreich und Spanien, beherrscht werden, scheint keiner Erklärung zu bedürfen, auch wenn sich Widerstände gegen die Kolonialmächte mal mehr mal weniger stark andeuten.
Außerdem bleiben Fogg und Passepartout das ganze Spiel hindurch imperiale Subjekte: Nur weil sie aus Großbritannien bzw. Frankreich kommen, können sie sich so frei bewegen. Passepartout, der zwar deutliche Sympathien für emanzipatorische soziale Bewegungen zeigen kann, bleibt gleichzeitig stets inbrünstiger Diener seines Herrn. Nur weil Fogg die finanziellen Mittel aufbringen und nahezu überall Kredite aufnehmen kann, um die Weiterreise zu bezahlen oder mit wertvollen Waren zu handeln, ist die Reise überhaupt möglich. Fogg in seiner stereotyp englischen Art bleibt ohnehin lieber mit sich allein und zeigt über weite Strecken kein besonderes Interesse für die Menschen und Lebensumstände in den Gebieten, die er durchquert. Und auch wenn Passepartout sich auffällig frei zwischen sozialen Schichten, Geschlechtern und Nationalitäten bewegt, exotisiert er häufig Fremde, die seinem europäischen Weltbild nicht entsprechen: »Passepartout constantly recalls his French heritage, faces ethnic misidentification due to appearances, and appreciates the difference between his manners and the way various peoples live.« 4 Aber auch das ist Teil der Inszenierung: Die Kontrastierung der pluralen und diversen Welt mit der Sozialisierung und Weltsicht des europäischen, weißen, männlich sozialisierten Weltreisenden.
In 80 Days findet die Spielerin keine dekolonisierte, heile Welt ohne jede Diskriminierung oder Ungleichheit. 80 Days ist eine geschickte Kombination aus fiktiven und historischen Elementen, mit der die Vielfalt menschlicher Lebensweisen beschrieben und historische und gegenwärtige Diskriminierungsformen problematisiert werden. Ein charmanter Ansatz, von dem sich so manches ›authentische‹ Historienspiel eine Scheibe abschneiden kann.
Über den Autoren:
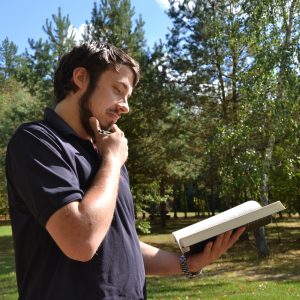 Jan Heinemann ist Historiker und Politikwissenschaftler. Unter dem Motto »Let’s Play History« spielt und fragt er nach erinnerungskulturellen Dimensionen historisierender Spiele. Twitter | YouTube
Jan Heinemann ist Historiker und Politikwissenschaftler. Unter dem Motto »Let’s Play History« spielt und fragt er nach erinnerungskulturellen Dimensionen historisierender Spiele. Twitter | YouTube
Behandeltes Spiel:
80 Days. 2015. Entwickler: Incle Ltd. Publisher: Incle Ltd/Cape Guy Ltd. Plattform: PC/MacOS (iOS/Android 2014).
Weiterführende Literatur
Edward Said: Orientalismus. Frankfurt am Main 2014.
Souvik Mukherjee: Videogames and Postcolonialism. Empire Plays Back, Cham 2017.
Răzvan Rughiniș/Ștefania Matei: History, biography and empathy in Inkle’s ›80 Days‹. In: Proceedings of Playing with History 2016 DiGRA/FDG Workshop on Playing with history: Games, antiquity and history, 2016. (http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/RUGHINIS-MATEI_PWH2A_1AUG_LT1.pdf)
- Using Games to Re-framing Our Past: an interview with 80 Days writer Meg Jayanth. Mooshme.org. (http://www.mooshme.org/2014/10/using-games-to-re-framing-our-past-an-interview-with-80-days-writer-meg-jayanth/)
- Meg Jayanth. Forget Protagonists: Writing NPCs with Agency for 80 Days and Beyond. Medium.com. (https://medium.com/@betterthemask/forget-protagonists-writing-npcs-with-agency-for-80-days-and-beyond-703201a2309)
- Meg Jayanth. Fantasy, History and Respect. megjayanth.com. (http://megjayanth.com/post/100280300365/fantasy-history-and-respect)
- Jed Pressgrove. 80 Days. Slatemagazine.com. (https://www.slantmagazine.com/games/review/80-days)












Eine Antwort
[…] Vernes In 80 Tagen um die Welt als Basis für Kolonialismuskritik verarbeitet wird, hat er dabei in Zwischen Anti-Kolonialismus und imperialem Subjekt: Geschichtsbilder in 80 Days verarbeiten. Dass das Spiel dabei nicht fehlerfrei bleibt, lässt er natürlich ebenfalls nicht […]